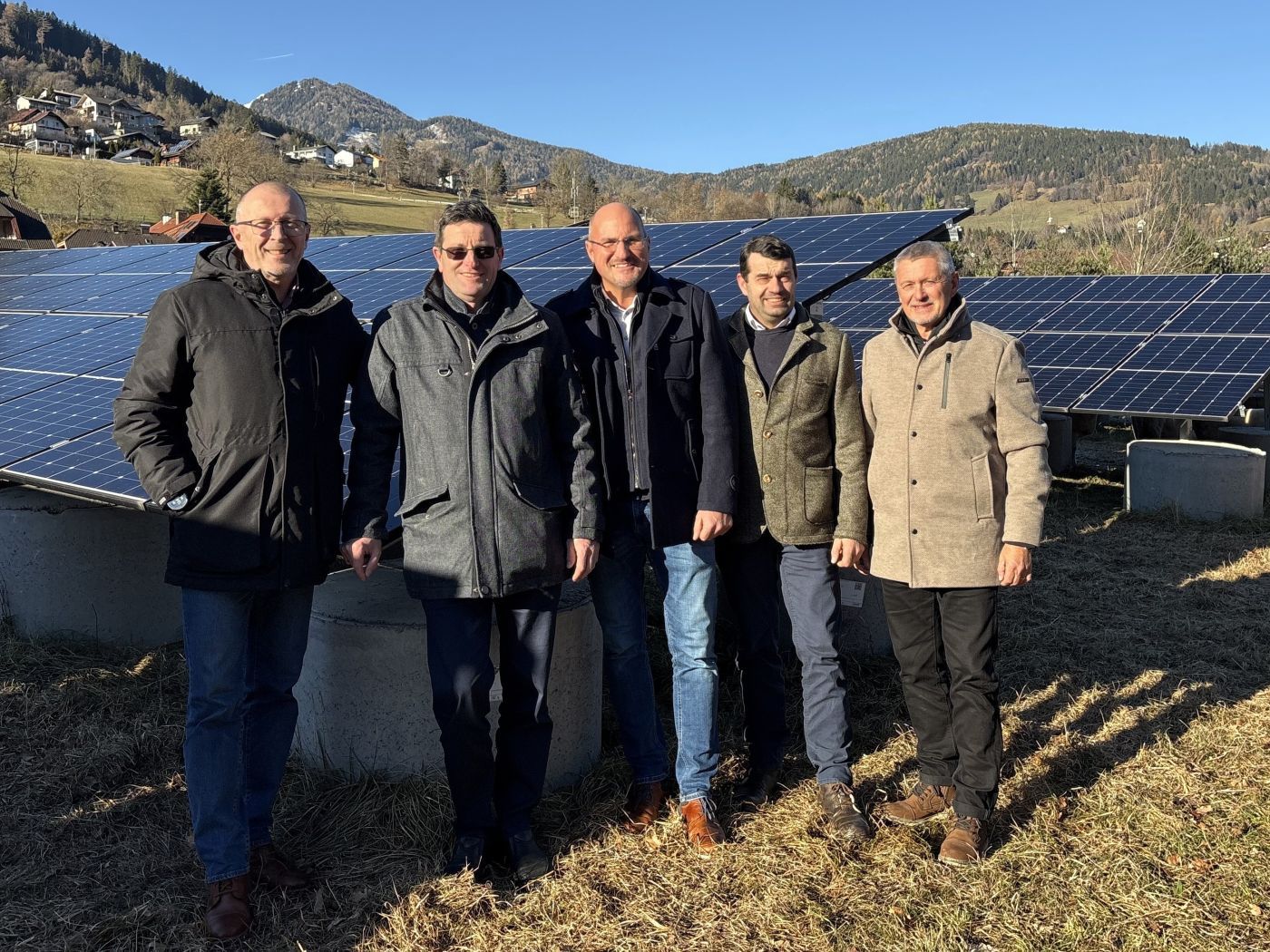Der jährlich erscheinende Kärntner Seenbericht stellt unseren Gewässern diesmal kein so gutes Zeugnis aus, wie in den Jahren davor. Die Seen haben zunehmend mit Nährstoffeinträgen zu kämpfen, was sich negativ auf die Wasserqualität auswirkt. Der klarste See Kärntens bleibt – wie immer – der Weißensee.

Zeitgleich mit dem Zeugnis für Kärntens Schülerinnen und Schüler wird seit bald 40 Jahren auch das „Zeugnis" für Kärntens Seen präsentiert. Umweltlandesrätin Sara Schaar legte gemeinsam mit Georg Santer vom Kärntner Institut für Seenforschung (KIS) den mittlerweile 39. Seenbericht vor. Insgesamt wurden (im Vorjahr 2024) 41 Gewässer auf ihre Wasserqualität überprüft. Dabei zeigte sich: Nur bei zwei Seen hat sich eine Verbesserung eingestellt (Feldsee und Moosburger Mühlteich), 14 Seen mussten schlechter eingestuft werden, bei 25 Seen zeigte sich keine Veränderung.
Beste Sichttiefe ...
Von den 41 untersuchten Seen wurden acht als „sehr nährstoffarm“ (ogliotroph) eingestuft, das ist gut für die Optik, denn weniger Nährstoffe bedeuten klareres Wasser und damit größere Sichttiefen. Der Weißensee ist seit jeher ein „Musterknabe“ in dieser Kategorie und glänzt auch beim aktuellen Bericht mit einer Sichttiefe von 9,8 Metern. Der Millstätter See hat hingegen nur eine durchschnittliche Sichttiefe von 6,8 Metern, der Pressegger See bei Hermagor 4,9 Meter. 19 Seen wurden im mittleren Nährstoffbereich eingestuft, vier als „eutroph“, neun als „stark eutroph“ und ein See als „hypertroph“, mit sehr vielen Nährstoffen und damit geringen Sichttiefen.
... aber ökologisch „unbefriedigend“
Die Nährstoffzunahme bereitet den Seenforschern Sorgen. Besonders betroffen seien kleinere Seen, die empfindlicher auf äußere Einflüsse wie vor allem den Klimawandel und die punktuell intensiven Niederschläge reagieren. Der ökologische Gesamtzustand eines Gewässers wird aber auch von anderen Qualitätskomponenten, wie der Fischfauna, den Unterwasserpflanzen, aber auch der Uferbeschaffenheit mitbestimmt. Der Faaker See, der Keutschacher See, der Klopeiner See und der Millstätter See wurden für ihre Ökologie mit „gut“ bewertet. Der Wörthersee, der Pressegger See und der Längsee sind im ökologischen Gesamtzustand nur mehr mit „mäßig“ eingestuft. Der Ossiacher See sowie der Weißensee wurden hingegen mit „unbefriedigend“ eingestuft. Beim Weißensee stuft der Bericht eben die Fischfauna mit „unbefriedigend“ ein, dieser Wert wird für die ökologische Gesamtbeurteilung herangezogen. Obwohl die Seen auf Umweltbedingungen reagieren, seien dramatische Entwicklungen derzeit nicht zu erkennen, heißt es weiter. Um die Gewässer-Güte auch zukünftig zu erhalten, bedarf es auch der Mithilfe eines jeden Einzelnen: Keinen Müll am Ufer liegen lassen, kein Füttern von Enten und Fischen und kein unnötiges Betreten empfindlicher Uferzonen gehören für die Seenforscher dazu.