90 freiwillige Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen naturwissenschaftlichen Disziplinen waren im Gradental und im Gartltal (beide Gemeinde Großkirchheim) der Artenvielfalt auf der Spur. Die Forscher nahmen im Rahmen der „Tage der Artenvielfalt“ sämtliche Pflanzen-, Tier-, Flechten- und Pilzarten der Täler unter die Lupe. Und es gab auch einen überraschenden Fund...

Mit 195 km² in der Glockner und Schobergruppe wurde im Jahr 1981 der erste österreichische Nationalpark gegründet. Das Gradental ist somit ein bedeutender Teil der österreichischen Nationalparkgeschichte. Als eiszeitlich geformtes Trogtal in den Hohen Tauern zeichnet es sich durch seine beeindruckende hochalpine Landschaft, die umliegenden Dreitausender sowie zahlreiche Karseen aus. Diese einmalige Landschaft haben die Forscher mit Kamera, Handy und Fangnetz einer Artenvielfalt-Inventur unterzogen. Erste Daten, die via der Online Datenplattform „Observation.org“ gemeldet wurden, zeigen nach dem Wochenende rund 3.600 Beobachtungen aus dem Gradental und dem angrenzenden Gartltal. Unter anderem wurden 950 Arten dokumentiert, davon etwa 500 Gefäßpflanzen, 150 Nachtfalter, 45 Tagfalter, 80 Vogelarten, 50 Käfer und 20 Heuschrecken – um nur einige zu nennen. Diese Zahlen sollten sich in den darauffolgenden Tagen und Wochen noch deutlich erhöhen, da für die Forscher die eigentliche Arbeit – die Bestimmung der Arten im Labor –erst nach dem Sammeln beginnt.
Überraschender Fund
Völlig überrascht war das Forscherteam vom „Haus der Natur“ über den Erstfund der Bedornten Höhlenschrecke (Troglophilus neglectus) in den Hohen Tauern. „Diese Art hätten wir hier überhaupt nicht vermutet“, so Tobias Seifert vom „Haus der Natur“, der das Tier fotografisch dokumentiert hat. Die Höhlenschrecke wurde – wie viele andere Arten auch – auf den sogenannten Eggerwiesen gefunden, die somit als wahrer Hotspot der Artenvielfalt bezeichnet werden können. Der hohe Artenreichtum ist aufgrund der Geologie und der nachhaltigen Bewirtschaftung der Bergmähder gegeben. Ein weiterer „Schatz“ ist das Leuchtmoos (Schistostega pennata), das in der Nähe der Adolf Noßberger Hütte entdeckt wurde. Es leuchtet nicht aktiv, sondern zeigt ein faszinierendes optisches Phänomen: Seine Zellen reflektieren das Licht wie ein Katzenauge, was das Moos bei bestimmten Lichtverhältnissen goldgrün schimmern lässt.
„Tage der Artenvielfalt“ wichtig für die Forschung
Seit 2007 finden die „Tage der Artenvielfalt“ im Nationalpark Hohe Tauern statt. Bisher konnten über 75.000 Datensätze gesammelt werden, das sind rund 12 % des Gesamtdatenbestandes der Biodiversitätsdatenbank des Nationalparks Hohe Tauern (620.000 Datensätze). „Die Sammlung von Daten, wie wir sie am Tag der Artenvielfalt durchführen, ist zwar aufwendig und liefert keine schnelle Dokumentation zu Veränderungen, wie sie in der heutigen Zeit oft gewünscht werden. Doch gerade in Zeiten von Fake News und aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen ist seriöse Forschung wichtiger denn je“, betonte Barbara Pucker, Direktorin des Nationalparks Kärnten, bei der Abschlusspräsentation.
Völlig überrascht war das Forscherteam vom Haus der Natur über den Erstfund der Bedrohten Höhlenschrecke. Foto: Tobias Seifert
Kommentare
Keine Kommentare







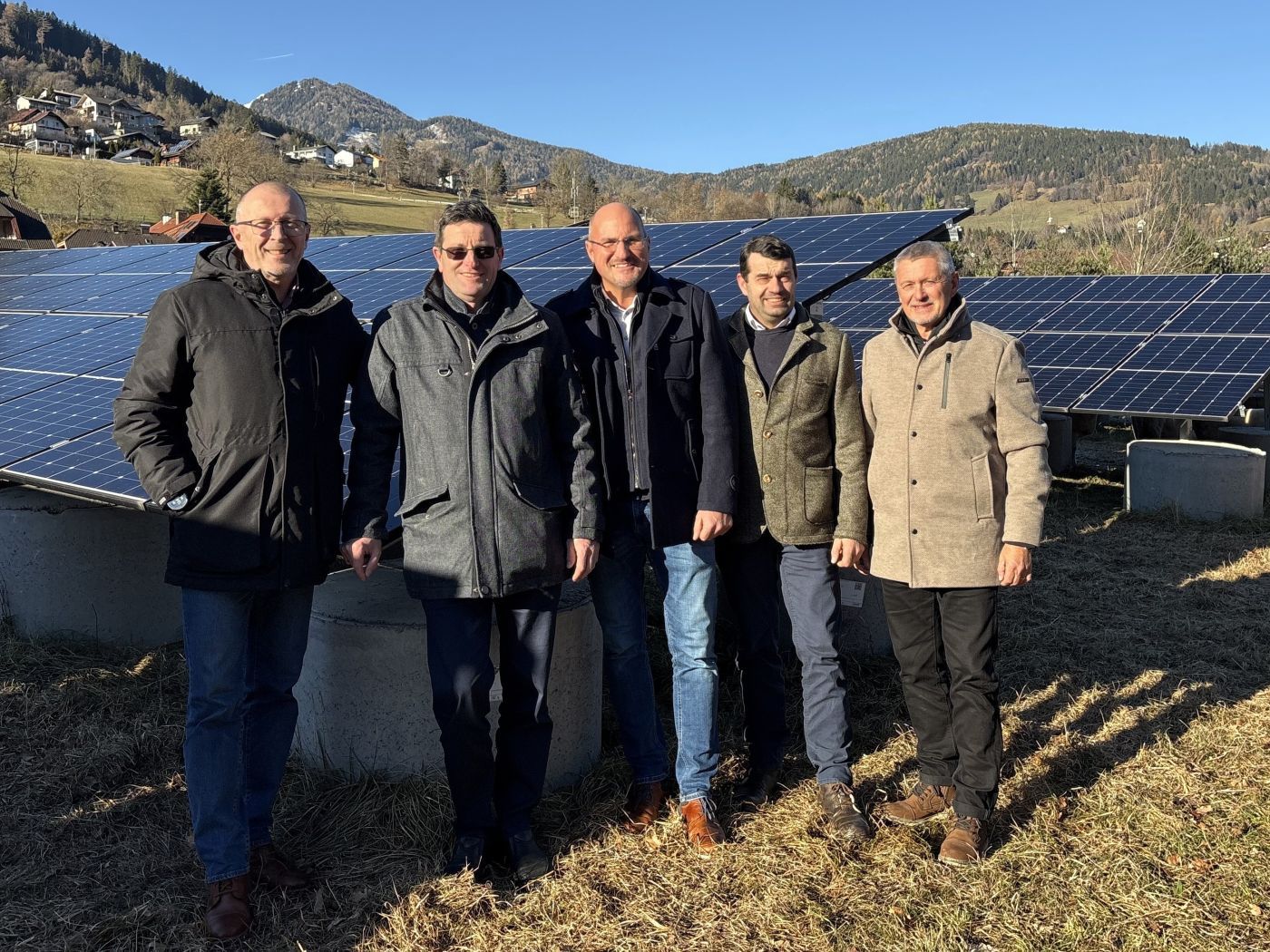




… für den persönlichen Einsatz aller Beteiligten an diesen mühevollen Arbeiten
… für das freudige Ergebnis der Nachforschungen
… für die Information
Danke !