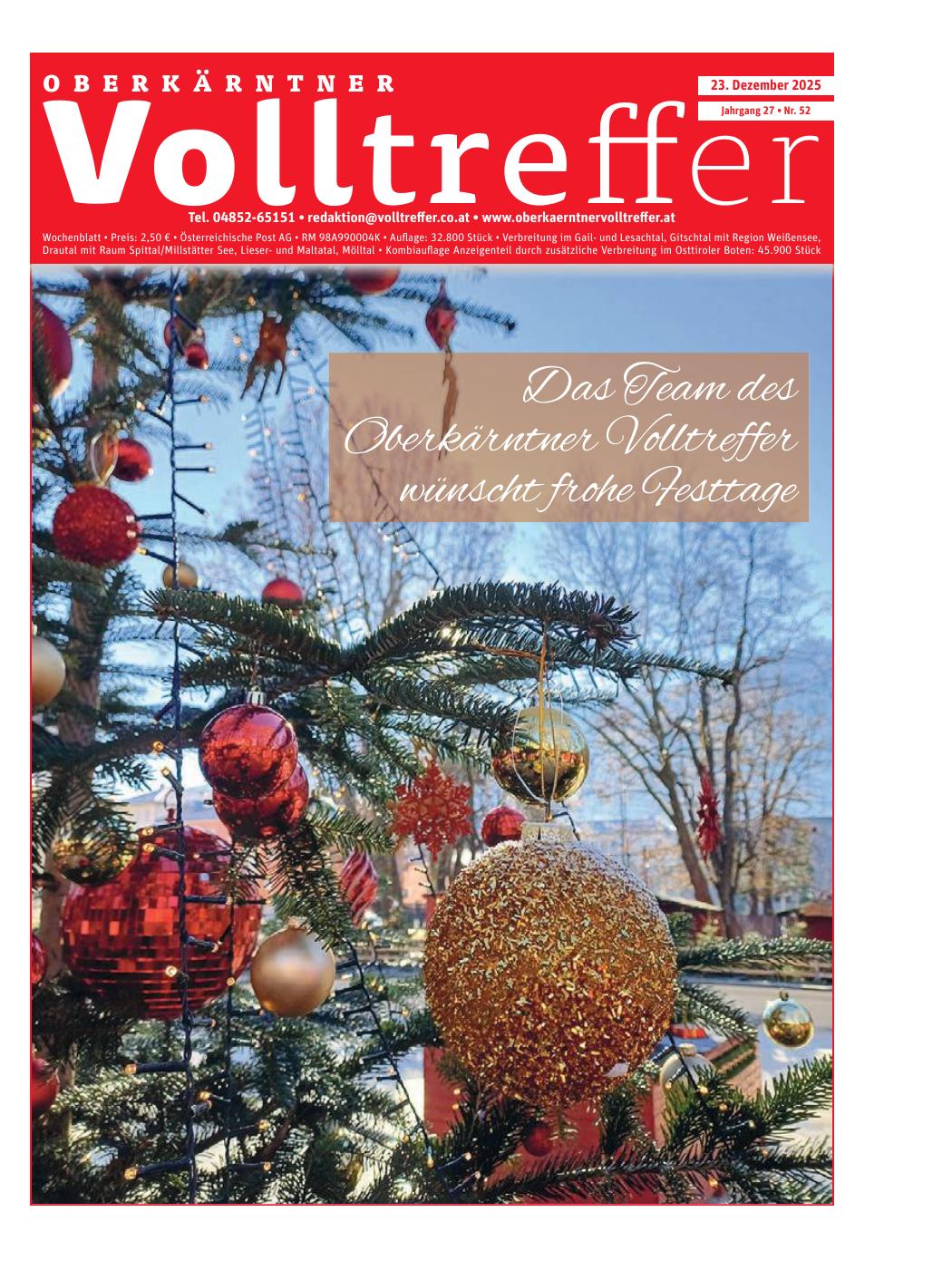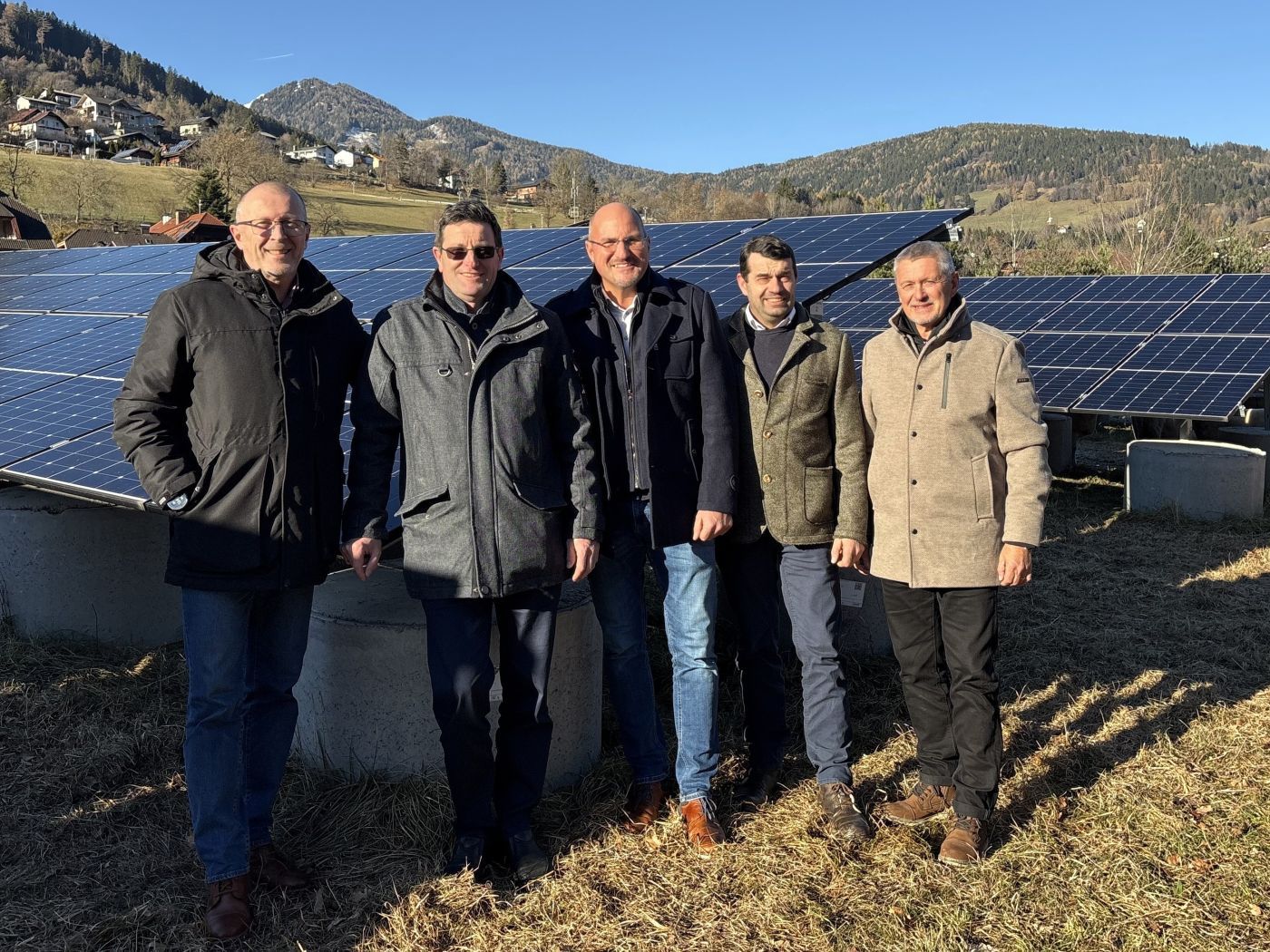Die Klimaveränderung, das Verhalten des Wildes und die Aktivitäten der Waldbenützern, wie z. B. Skitourengehern belasten den Neuaufwuchs von Borkenkäfer-geschädigten und abgeholzten Schutzwälder im Oberen Mölltal stark. Im Dialog „Wald, Wild & Wir“ ging man der Frage nach, wie man diese jungen Schutzwälder beschützen kann.

Im Oberen Mölltal sind sie nicht zu übersehen, die kahlen, abgeholzten Berghänge, die einst Schutzwälder für die darunterliegenden Ortschaften trugen. Durch Starkwinde und Borkenkäfer sind diese Schutzwälder großteils verschwunden. Zwar wurde aufgeforstet, aber der aufkommende Schutzwald hat mit mehreren Problemen zu kämpfen. Durch Wildverbiss kommen viele kleine Bäume nicht auf. Eine Verbindung gibt es hier zu den Freizeit-Aktivitäten von Heimischen und Gästen. Wie man hier entgegensteuern könnte, wurde in der „Kultbox“ in Mörtschach diskutiert. Am Podium standen KLAR! Managerin Sabine Seidler, Melitta Fitzer, Christian Dullnig von der Forstaufsicht Winklern und Elisabeth Fladerer, die sich in Osttirol mit Besucherlenkung beschäftigt.
Wildverbiss als Problem
Christian Dullnig startete mit einer Bestandsaufnahme von 5 lokalen Wildfreihaltezonen (hier wird Schalenwild entnommen trotz Schonzeit und ungeachtet des Abschulssplanes). Eine zweijährige Untersuchung in einer Wildfreihaltezone am Mörtschachberg habe ergeben, dass es trotz intensiver Bejagung einen großen Wildbestand gibt. Das Resultat: In den letzten drei Jahren wurden 64% der Bäume mindestens einmal verbissen. Dies verlangsamt die Neubewaldung des Schutzgürtels um die Ortschaften. Seine Erfahrungen mit den Wildfreihaltezonen brachte der Vorarlberger Wildökologe Hubert Schatz ein. Die Nutzung der Bergtäler in Vorarlberg führe – ähnlich wie in Kärnten – zu einer Konkurrenz zwischen Wild, Eigentümern, Jägern, Einheimischen und Touristen. Damit der Schutzwald dort seine Ruhe hat, wurden Flächen in Gebiete mit Schwerpunktbejagung, in Wildruhezonen und in Überwinterungsgebieten mit Fütterung eingeteilt, die Wildtiere in die gewünschten Gebiete „lenkten“. In den Schwerpunktbejagungsgebieten wird das Wild stark reguliert. Von Vorteil zeigte sich die Zusammenarbeit von Jägern und Waldbesitzern. Diese Schwerpunktbejagungsgebiete machen auf der anderen Seite einen Ausweichraum für das Wild, ein sicheres Rückzugsgebiet notwendig. Um die Gebiete mit Schwerpunktbejagung entstand eine Pufferzone mit gemäßigter Bejagung, die das Wild weiter zu Ruhezonen lotsen, wo es nur mehr mit störungsarmen Intervalljagden konfrontiert wird. Das System funktioniere gut, was sich an der Verjüngung des Schutzwaldes mit tragbarem Wildverbiss zeige.
Besucherlenkung als Möglichkeit
Als weiterer Hemmschuh für das Aufkommen von Schutzwäldern gelten Freizeitnutzer, hier vor allem Skitourengeher. Dieses Thema griff Elisabeth Fladerer auf, die das langjährige Tiroler Besucherlenkungsprogramm „Bergwelt Tirol-miteinander Erleben“ vorstellte. Wintersportler werden durch Info-Tafeln und Medien um die Wild-Winterruhezonen gelenkt, sodass diese nicht auf die aufwachsenden Schutzwälder ausweichen. Das Programm wurde bereits in großen Bereichen Osttirol umgesetzt. Die Besucherlenkung erfolgte hier vor allem durch Angebote, Information und Aufklärung. Lenkung funktioniere laut Fladerer nicht, wenn sie nicht freiwillig ist, wenn Verbote im Vordergrund stehen. Lenkung funktioniert, wenn das Angebot stimmt. Im anschließenden Gespräch wurde die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen diskutiert, das Interesse an einemähnlichen Prozess bekundet, und um die Unterstützung der Behörden und des Land Kärntens bei einem Programm im Oberen Mölltal gebeten.